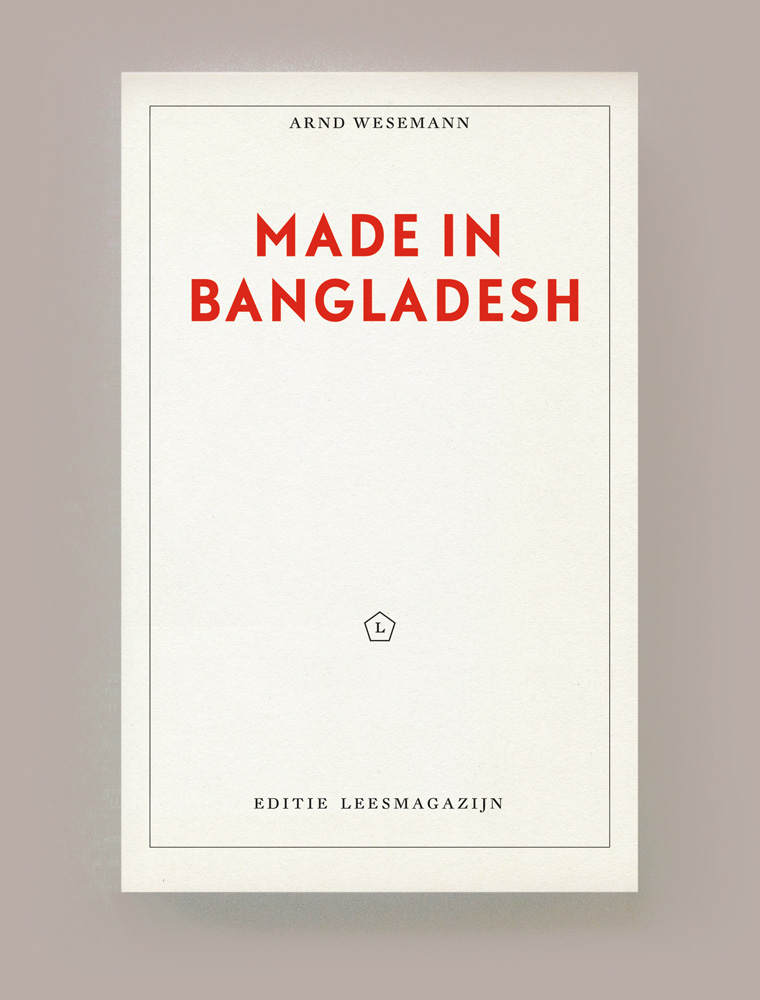Von der Politik verordnet
ist ein Leberecht des Theaters nur noch dann garantiert, wenn es sozial oder sozial engagiert ist. Intern dürfen dafür weiterhin Bedingungen herrschen wie in einer Freihandelszone. Die hierarchische Struktur der Theater bleibt unangetastet, gerade durch ökonomische Prämissen wie Platzausnutzung und Eigeneinnahmen. Bereits 2013 erschien in der Fachzeitschrift „Theater heute“ dieser Leserbrief eines Chefarztes an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Bad Mergentheim. Christoph Eingartner, der zugleich ärztlicher Direktor der Gesundheitsholding Tauberfranken mit rund 2000 Mitarbeitern ist, zuständig also für eine mittelständische GmbH. Er weiß, wie ein öffentliches Krankenhaus in ökonomischer Hand funktioniert: immer noch anders als ein von der Politik dominiertes Theater, das so tut, als würde es auf soziale Bedürfnisse eingehen: „Das Theater als Betrieb, als Unternehmen und seine Unternehmenskultur“, schreibt er, „scheint mir im Wesentlichen autoritäre Führung durch einen Intendanten zu sein, der für den Zeitraum seines Vertrages temporäre Unfehlbarkeit erhält. Selbstverständlich sieht man sich politisch links, jedenfalls gesellschaftskritisch, will die Fragen der Zeit aufgreifen, will politisch relevantes Theater machen, so oder so ähnlich liest man es in jedem Spielzeitheft. Man reckt die virtuelle Arbeiterfaust, aber für die Führung des eigenen Unternehmens hat die politische Grundhaltung keine Relevanz.
Da wird in bester CEO-Manier die Produktivität gesteigert, mehr Vorstellungen und Produktionen mit bestenfalls gleichbleibender Ensemblestärke: Wenn es letzte Spielzeit ging, dass ein Schauspieler zehn Stücke parallel macht, dann wird es in der nächsten Spielzeit doch auch mit zwölf Stücken gehen. Da lässt man sich als Intendant gerne feiern (oder tut es im Zweifelsfalle gleich selbst), dass man noch nie so viele Vorstellungen wie in der abgelaufenen Spielzeit hatte und noch nie so viele Zuschauer erreichen konnte und gelobt ‘Kostendisziplin’ bei weiter steigender Produktivität. Kapitalistische Ausbeutung ist das nur, wenn es die anderen tun.
Die Schere öffnet sich immer weiter. Auf der einen Seite ist das Prekariat der Schauspieler, die von Vertragsverlängerung zu Vertragsverlängerung hoffen (sofern sie nicht ohnedies ‘frei arbeiten’, ein netter Ausdruck für die aparte Mischung aus Hartz IV, berufsfremden Gelegenheitsjobs und gelegentlichen Stückverträgen). Und auf der anderen Seite die Riege der Jet-Set-Regisseure, denen an allen Häusern der rote Teppich ausgerollt wird und deren üppige Gagenforderungen gerne bedient werden. Das kann man ja alles akzeptieren, das Theater als Spiegelbild der Gesellschaft, aber dann muss man das auch sagen und sich nicht in heuchlerischer Verlogenheit als Kapitalismuskritiker stilisieren.
Technik, Maske, Verwaltung, da wird fleißig gearbeitet und zumeist schlecht verdient, aber hier gelten die Regeln eines normalen Betriebes, Arbeitsverträge, Kündigungsschutz, Arbeitszeitgesetz und all diese Rand- und Rahmenbedingungen, die für Unternehmen eben ganz selbstverständlich sind. Für Schauspieler gilt das alles nicht. Verträge werden so geschlossen, dass der nachfolgende Intendant das bestehende Ensemble möglichst rückstandsfrei entsorgen kann. Bevor Unkündbarkeit – nach 15 Jahren – droht, wird ein Vertrag flugs gekündigt oder zumindest unterbrochen, aus ‘künstlerischen Gründen’ selbstverständlich. Ensembles werden immer jünger, um mit Anfängergagen Geld zu sparen. Wenn man tatsächlich mal eine ‘alte Frau’ jenseits der 40 braucht, kann man die ja als Gast zukaufen, der Markt an frei arbeitenden Schauspielern ist riesig, die Bedingungen können fast beliebig diktiert werden (gerne: Bezahlung pro Aufführung, Proben unbezahlt). Die Grundlagen abendländischer Kultur und Höflichkeit dürfen hintangestellt werden, wenn es um den Umgang mit Schauspielern geht. Das Ignorieren von Gesprächswünschen, Regieren nach Gutsherrenart, der Besetzungszettel kommt per Mail und ohne Kommentar. Die Drohung mit der Nichtverlängerung, es sei denn, die Schauspielerin jenseits der 35, zu der einem nach jahrelanger Zusammenarbeit urplötzlich ‘künstlerisch nichts mehr einfällt’, sei bereit, wieder auf die Mindestgage zurückzugehen. Das schamlose Bedrohen und Verunglimpfen von Darstellern, wenn diese auf ihre ohnedies spärlichen Rechten bestehen. Die Frechheit, einer schwanger gewordenen Schauspielerin hinzuwerfen, sie mache jetzt wohl ‘einen auf Sozialfall’. Die Kultur der Zuträgerschaft, das Ermuntern von Denunziantentum in schöner Tradition vergangen geglaubter Stasi-Zeiten. Einhalten vereinbarter Probezeiten? Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Nicht so wichtig, denn wer kann von einem Schauspielergehalt schon eine Familie ernähren? Es zeugt von hoher Kunst des Doppeldenkens, gleichzeitig Kapitalismuskritik zu üben und seinen eigenen Laden in so entspannter Frühkapitalisten-Manier zu führen, wie es in anderen Unternehmen schon lange nicht mehr möglich und üblich ist. Das Unternehmen, für das ich Verantwortung trage, wäre schon längst pleite, würden wir unsere Leistungsträger so behandeln, wie das die Theater mit den ihren tun.“