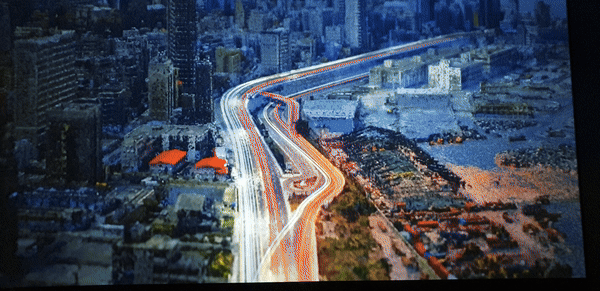Um den desolaten Theatern in Beirut endlich zu entkommen, ließen sich die Tänzerin Mia Habis und ihr Ehemann Omar Rajeh aus einfachen Elementen eine gigantische, mobile Theaterkuppel bauen, die Citerne. Sie war ein Wunder an mobiler Theaterarchitekur, das 2017 nach dem Bipod-Festival gleich wieder abgebaut werden musste, da die beiden sich weigerten, den Gouverneur aus Beirut um Schirmherrschaft zu bitten. Auch er ist längst nicht mehr in einem Amt, in dem er jahrelang eine Nationalbibliothek ohne Bücher so verwaltete wie das alte, im Stil des Brutalismus erbaute Kino „The Egg“ am Märtyrerplatz. Dieser Leerstand wurde am 17. Oktober 2019 von Demonstranten ebenso entschlossen beendet wie ein paar Meter weiter der Leerstand des ehemaligen Opernhauses – beide sind in nach wie vor schauerlichem Zustand. Die Demonstrationen gegen die Regierung wirkten, die Proteste gegen die Entleerung der Staatskasse, gegen den Diebstahl des eigenen Geldes durch die Bank, gegen die massive Korruption, kurzum: gegen den Staat als solches.
Die Citerne lagert nun oben im Mount Lebanon, dem Beirut überragenden Bergzug und Rückzugsort der Libanesen während der heißen Sommermonate. Dort schmoren die ausgelagerten Tanzteppiche in Containern und die gebogene Dachkonstruktion in der Sonne, erzählt Mia Habis, Nur einiges technische Equipment wurde nun wieder ausgepackt, Tontechnik und Scheinwerfer, um das zwanzigjährige Bestehen des Bipod-Festivals zu begehen, als ein „Fest“, wie Omar Rajeh betont. Denn lange haben sie gezweifelt am Sinn eines internationalen Tanzfestivals auf Beiruter Boden. Eine Parade durch die ganze Stadt ziehen zu lassen, wie es die Biennale de Lyon in ihrer neuen Heimat betreibt, konnten sie sich ihrer alten Heimat so wenig vorstellen wie ein Schaulaufen von Tanzstars, um deren Karten sich ein Publikum schon Monate vorher balgt. Das ist nicht Beirut.
Beirut ist eine Community, die zusammenrückte, nach der Staatspleite, nach Covid und seinem noch heute sichtbarsten Menetekel, der Siloexplosion, die ganze Stadtviertel im Osten Beiruts wie den Central District, Mar Mikhael, Al Hikme und Karantina beinahe dem Erdboden gleich machte, und auch entferntere, aber erhöhte Orte wie Mar Mitr mit seinem berühmten Sursock-Museum schwer beschädigte.